Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Rücken an Rücken
| ISBN | 3100226054 | |
| Autor | Julia Franck | |
| Verlag | S. Fischer | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 384 | |
| Erscheinungsjahr | 2011 | |
| Extras | - |
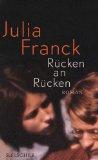
Rezension von
Dr. Benjamin Krenberger
Wie schon in ihrem preisgekrönten vorigen Roman âDie Mittagsfrauâ geht es den Kindern im neuen Roman âRücken an Rückenâ auch nicht viel besser. Es ist faszinierend, mit welcher Kühle hier psychische und körperliche Negativerlebnisse aneinander gereiht werden, sodass man den fortbestehenden Lebenswillen der Protagonisten eigentlich nur in Zweifel ziehen kann, was sich am Ende sogar bewahrheitet. Ella und Thomas wachsen vaterlos bei ihrer Mutter, einer gleichzeitig groÃbürgerlich und kommunistisch beeinflussten Bildhauerin in der frühen DDR auf. Man erlebt die Zeit bis kurz nach dem Mauerbau, als die Kinder das 18. Lebensjahr gerade vollendet haben dürften.
weitere Rezensionen von Dr. Benjamin Krenberger

Der Titel des Romans liegt darin begründet, dass die beiden Kinder, aufeinander angewiesen und eng verbunden, beim Erzählen vertraut Rücken an Rücken saÃen, bis auch dies in späteren Jahren abebbt. Beide erleben auf unterschiedliche Weise eine furchtbare Kindheit, geprägt von mütterlichem Desinteresse und willkürlich-diktatorischem Umgang in der Familie. Leistungen und Geschenke der Kinder werden nicht beachtet, eine dreitägige Flucht wird nicht einmal bemerkt, zusätzlich vorhandene jüngere Zwillinge werden sogar ins Pflegeheim abgeschoben. Ella wird vom Stiefvater jahrelang missbraucht und vergewaltigt, danach von einem neuen Untermieter, der sogar auf Anraten des Stiefvaters in das Haus gezogen ist, um sie fortan benutzen zu können. Das Aufbrechen des Badezimmers, um Ella in der Wanne zu vergewaltigen, hinterlässt bei ihr das gewaltigste Trauma mit anschlieÃendem Aufenthalt in der Psychiatrie. Interessant ist, dass die tatsächliche Form des Missbrauchs erst mit zunehmendem Alter von Ella auch von ihr in Worten konkretisiert wird, ein schönes Stilmittel. Dazu kommen das Versagen in der Schule und die fehlende Mutterliebe. Die Mutter unterstellt ihr (zu Recht) Diebstahl von Lebensmitteln und schenkt ihr deshalb (nur) einen Berg Zucker zum 16. Geburtstag, den sie essen solle, bevor sie wieder echte Nahrung zu sich nehmen dürfe. Thomas vermutet ab diesem Zeitpunkt eine beginnende anorektische Veranlagung der Schwester, die jedoch nicht weiter zum Thema des Buches wird.
Thomas hingegen verzweifelt an seiner Machtlosigkeit gegenüber dem Missbrauch der Schwester und der Bevormundung durch die Mutter, was seine Berufswahl angeht. Er muss seinen Wunsch, Journalist zu werden, aufgeben und wird zur Vorbereitung eines Geologiestudiums zum Arbeitseinsatz in ein Bergwerk geschickt, wo er mit Abitur und schmächtiger Statur natürlich nach allen Registern drangsaliert und gedemütigt wird. Wegen einer Erkrankung wird er dann aus dieser Beschäftigung entlassen und muss nach dem Wunsch der Mutter sodann eine Tätigkeit als Hilfspfleger an der Charité in Berlin antreten, um sich auf ein Medizinstudium vorzubereiten. Auch diese Stelle hat er nur über Beziehungen der Mutter erlangt, die er für dieses Sich-Verkaufen an einen Unrechtsstaat eigentlich verachtet, aber deren Willen er sich nicht zu widersetzen wagt. Im Gegensatz zu Ella, die immer nur ihren eigenen nächsten Schritt vor Augen hat, bemerkt Thomas die zunehmende Unfreiheit in der DDR und prangert diese auch gegenüber der Mutter an, die ihn aber, wieder einmal, abbürstet. Seine einzige Verarbeitung der für ihn untragbaren Situation bleiben seine zahlreichen Gedichte, die, so das Nachwort, als realen Hintergrund einen ebenfalls jungen Autor haben, der sich wie am Ende Thomas das Leben nimmt.
Nicht nur unter diesem Aspekt ähnelt die Figur des Thomas dem Protagonisten in Hesses Unterm Rad, aber auch ganz allgemein wird der missglückte Aufbruch des stürmischen jungen Geistes Thomas in einem abgeschlossenen Unrechtsstaat brillant eingefangen und zu einem konsequenten Ende geführt. Allerdings ist die tatsächliche Auseinandersetzung mit den Einengungen der DDR weit geringer, als sie Klappentext und sonstige Rezensionen glauben machen wollen. Vielmehr ist es eher ein sehr persönlicher Ausschnitt zweier junger Menschen, deren Verallgemeinerbarkeit für die Jugend der damaligen Zeit völlig offen bleibt. Das ist eigentlich schade, denn die Auseinandersetzung mit den engen geistigen Grenzen innerhalb der DDR und die psychischen Erniedrigungen der beiden Kinder durch die ideologische Verbohrtheit der Mutter hätte gut und gerne der maÃgebliche Aufhänger des Buches werden können und sind schon an sich genug psychisch belastender Stoff für zwei aufwachsende Menschen. Die dazu kommende sexuelle Gewalt lässt das Buch hingegen in Abgründe driften, die weder inhaltlich noch sprachlich nötig gewesen wären. Dies betrifft nicht nur Ella, sondern auch noch eine Bekanntschaft von Thomas aus der Charité, in die er sich am ersten Tag des Dienstantritts verliebt, die aber von ihrem Mann an dessen betrunkene Freunde verkauft wird und dies mitmacht, weil sie ihr Kind nicht verlassen zu können glaubt. Warum sie dann am Ende mit Thomas doch den Suizid durch eine Ãberdosis Morphium begeht und dann doch ihr Kind zurücklässt, bleibt ein ungelöstes Rätsel. Allerdings ist auch hier die Verzweiflung von Thomas, die mit der Zuneigung zu Marie und sexuellen Anziehung Maries auf ihn ringt, wunderbar aufgegriffen und lässt den Leser intensiv mitleiden.
Das Buch ist wie schon die Mittagsfrau hervorragend geschrieben und nimmt den Leser mit durch alle Untiefen bis hin zu einem dramatischen, aber bezüglich Ella offenen Ende. Wer herzerfrischende oder lustige Lektüre sucht, ist hier natürlich fehl am Platz. Die Tragik und Dramatik der Erlebnisse der beiden Kinder, die gefühlte Machtlosigkeit und Hilflosigkeit, das Leiden an falschen Utopien und wahren Erkenntnissen und letztendlich die ständige Konfrontation mit der eigenen geistigen und körperlichen Unfreiheit machen das Buch zu einem eindrucksvollen und lang nachhallenden Leseerlebnis.
geschrieben am 25.03.2012 | 838 Wörter | 5029 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen