Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Das Autorenfoto in der Medienrevolution
| ISBN | 3770549481 | |
| Autor | Matthias Bickenbach | |
| Verlag | Fink | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 430 | |
| Erscheinungsjahr | 2010 | |
| Extras | - |
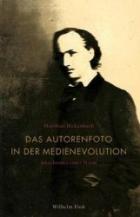
Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
Um 1842 existierte noch kein allgemein bekanntes Bild vom Schriftsteller Charles Baudelaire. Die Photographie war gerade erst erfunden worden und steckte noch in den Kinderschuhen. Das Bild, was man in Paris von Baudelaire hatte, ergab sich aus seinen Dichtungen, durch GerĂŒchte und ErzĂ€hlungen.
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Sein spĂ€terer Freund, der Photograph Felix Nadar, beschrieb viele Jahre spĂ€ter die erste Begegnung mit dem legendenumwitterten BohĂšmien: »Plötzlich stockte unser GesprĂ€ch beim Anblick einer seltsamen, geisterhaften Gestalt. (âŠ) Wir sahen einen jungen Mann von mittlerer GröĂe und guter Figur, bis auf einen rotbraunen Schal, ganz in Schwarz. Sein Rock war tadellos geschnitten, mit einem enormen Schalkragen, aus dem sich der Kopf erhob wie ein Bukett aus seiner UmhĂŒllung (âŠ) In seiner Hand, die in einem hellrosafarbenen - ich wiederhole: hellrosafarbenen â Handschuh steckte, trug er den Hut, der die ĂberfĂŒlle des gelockten, tiefschwarzen Haares, das ihm auf die Schulter fiel, entbehrlich machte â eine MĂ€hne wie ein Wasserfall. So sollten wir ihm also begegnen, dieser sehnlich erwarteten Gestalt, dieser erhabensten Attraktion.«
Die Anwesenden waren nicht nur ĂŒber die Erscheinung Baudelaires als solcher verwundert. Vielmehr setzte sie der Unterschied in Erstaunen zu dem Ruf, den der Dichter hatte: Aufgrund seiner provokanten Texte erwartete man einen ungepflegten, ĂŒbel riechenden und heruntergekommenen Mann auĂerhalb der Gesellschaft.
Matthias Bickenbach untersucht in seiner detaillierten Studie "Das Autorenfoto in der Medienrevolution â Anachronie einer Norm" das Autorenfoto nur als Beispiel. Er will die allgemeine Ansicht in Frage stellen, die Photographie als Medium hĂ€tte eine Revolution zur Folge gehabt. Eine Revolution vor allem in der Wahrnehmung und der Betrachtung von Bildern. Seine Habilitationsschrift nutzt das Autorenfoto, um die These zu belegen, die heute allgemeingĂŒltige Annahme von der Revolution jeweils neuer Medien sei in Wahrheit stets eine Evolution.
Das Beispiel Baudelaires ist deshalb so interessant wie aufschlussreich, weil er die Photographie tiefgrĂŒndig nutzte und in sein Gesamtkunstwerk einbaute. Zu diesem Gesamtkunstwerk gehörten ĂŒber seine Dichtung hinaus auch sein Auftreten und seine Vermarktung. Baudelaire gilt heute unbestritten als einer der gröĂten Erneuerer der Literatur im 19. Jahrhundert. Sein Rang liegt wohl ĂŒber dem von Balzac oder Hugo. Zu Lebzeiten war er allerdings finanziell nicht sonderlich erfolgreich. So nutzte er die neu aufkommende Photographie als wichtiges Mittel der Selbstinszenierung. Er lieĂ von Felix Nadar gleich ganze Serien von Portraitphotos von sich anfertigen und plante sogar, ein Bild als Frontispiz sĂ€mtlicher BĂŒcher zu nehmen. Theoretisch lehnte Baudelaire die Photographie ab, weil sie einen falschen Anschein von ObjektivitĂ€t und Bildlichkeit vermittle. Aber genau deshalb wusste er sie auch zu nutzen.
Bickenbach interpretiert das erste heute noch bekannte Photo Nadars: Baudelaire sitzt lĂ€ssig zurĂŒckgelehnt; sein schwarzer langer Mantel betont die BohĂšme-Zugehörigkeit. Aber vor allem betont der Autor die versteckten HĂ€nde Baudelaires: »Indem Baudelaire seine HĂ€nde versteckt, entzieht er sie nicht nur der Sichtbarkeit. Die Hand des Dichters ist immerhin selbst das Medium seiner Handschrift und damit ein symbolisches Zeichen, das in der Tradition der Bilder von Gelehrten und SchriftautoritĂ€ten fest etabliert ist. Die Geste der âHand in der Hosentascheâ korrespondiert einer Haltung des Autors im Zeitalter seiner Fotografierbarkeit, die der Autorschaft mit einem visuellen Entzug, dem Entzug der schreibenden Hand verbindet.« Bickenbach interpretiert, Baudelaire prĂ€sentiere sich hier bewusst nicht in der bisherigen Pose der GroĂdichter, sondern antibĂŒrgerlich. Die Geste der HĂ€nde in den Hosentaschen habe »nicht nur politische und soziale, sondern auch literarische Valenz als Habitus einer Distinktion«.
Bickenbachs Untersuchung fragt nach der Rolle des photographischen Portraits literarischer Autoren und damit auch nach ihrer Wirkung, nach ihrem Einsatz durch die Autoren selbst und nach weiteren Implikationen, Folgen und hĂ€ufig ungeprĂŒften Annahmen. Schon lange vor der Photographie gab es plastische Bildnisse von Autoren. Diese dienten schon vor Jahrhunderten dem gleichen Zweck: Man konnte sich buchstĂ€blich âein Bild machenâ, von dem Autoren, den man las. Folgt man den AusfĂŒhrungen Bickenbachs, gerĂ€t die bisherige, ungeprĂŒfte und unterbewusst als feststehend akzeptierte Annahme der Revolution durch das Aufkommen der Photographie und anderer neuer Medien ins Wanken. Vielmehr erhĂ€lt der interessierte Leser ein GefĂŒhl fĂŒr den ewigen evolutionĂ€ren Prozess. FĂŒr Zeitgenossen ergeben sich die VerĂ€nderungen stets flieĂend, sei die Geschwindigkeit auch noch so schnell. Umso gröĂer jedoch der zeitliche Abstand der historischen Betrachtung, desto stĂ€rker wird die rĂŒckblickende Perzeption zur âRevolutionâ.
geschrieben am 01.09.2010 | 685 Wörter | 4320 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen