Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Das gibts in keinem Russenfilm
| ISBN | 310002298X | |
| Autor | Thomas Brussig | |
| Verlag | S. Fischer | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 384 | |
| Erscheinungsjahr | 2015 | |
| Extras | - |
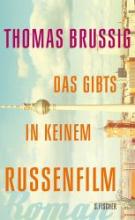
Rezension von
Dr. Benjamin Krenberger
Man möchte sich nur zu gerne vorstellen, wie sich Thomas Brussig über die Deutungsversuche zu seinem neuesten Roman „Das gibts in keinem Russenfilm“ amüsiert. Denn was er da erschaffen hat, ist eine Mischung aus (fiktiver) Autobiographie, (fiktivem) historischen Roman und einer gesunden Prise ironischen Austeilens gegen sich selbst, Freund und Feind – nur dass man oft nur erahnen kann, wen er neckisch überzieht und wen er wirklich nicht leiden kann. Insbesondere im letzten Drittel des Buches räsoniert er sogar über das Buch im Buch, über die fiktive Geschichtsweiterschreibung und postuliert fast schon schelmisch: Wozu also die Zeit mit etwas vergeuden, das erkennbar Unsinn ist? - Wie etwa das fiktive Fortschreiben der DDR mag man erfreut dazwischenrufen. Denn genau das tut Brussig auf zuvor bereits 300 Seiten. Es gab keinen Mauerfall, es gab keine Wende und der echte / falsche, je nachdem, Brussig lebt in der DDR, wächst dort auf, mit Mangel, Altstoffsammlung, Volkspolizei, Stasi, Zuteilungssystem, Unfreiheit wohin man auch sieht. Dies wird sein Thema als Schriftsteller, die Freiheit. Damit fordert er natürlich immer stärker den Staat heraus, doch der kommt ihm nicht bei. Brussig hält stoisch an der DDR und seinem Verbleib in ihr fest, insbesondere aufgrund eines spontanen, aber obskuren öffentlichen Schwurs - auch wenn er schon im Westen verlegt und gelesen wird, auch wenn seine Freundin, schwanger auch noch, in den Westen übersiedelt und damit sein erstes großes Glück zerstört wird, auch wenn ihm durch den Staat Knüppel zwischen die Beine geworfen werden.
weitere Rezensionen von Dr. Benjamin Krenberger

Bis ins Jahr 2014 hinein schreibt er die DDR fort, nicht aber streng aus der gesellschaftlichen oder historischen Perspektive, sondern auf der Sekundärebene, d.h. aus der Sicht des Menschen und Autors Brussig, der eine neue Familie gründet, der dann doch Westreisen unternehmen kann und der irgendwie von der Entwicklung überholt zu werden scheint, die mit dieser fiktiven DDR einhergeht: diese wird zum Pionier in Sachen Windkraft und Elektromobilität und gesundet auf diese Weise wirtschaftlich, was wiederum den Unmut der Bevölkerung besänftigt und das Streben nach Freiheit gar nicht mehr so begehrenswert erscheinen lässt. Ein ökologischer, exportfähiger Kommunismus bahnt sich an, eine Horrorvorstellung für (den fiktiven) Brussig.
Neben dieser Rahmenhandlung wird, auch anhand vieler real existierender Personen, die Geschichte der DDR ausgeschmückt, und man hat allerhand zu tun, um die vielen Anspielungen, Querverweise und Seitenhiebe auf Künstler, Schriftsteller, Kritiker, Politiker und andere zu erkennen und zu dechiffrieren, siehe oben. Viele spontane, manchmal herbe Lacher stellen sich ein, etwa wenn er über die Schriftstellerkollegen Tellkamp, Urban, Hein oder Grass schreibt und unkt, wenn er das Phänomen Udo Lindenberg zu erfassen sucht, den Regisseur Leander Haußmann ausfällig werden lässt oder einfach mal seinen eigenen Roman über die Sonnenallee einem anderen Autor zuordnet.
Insgesamt eine hübsche Idee, luftig komponiert und flott geschrieben. Mit der nötigen Nonchalance und Lakonie des ungewollten Dissidenten, der Brussig nie gewesen sein könnte, oder doch, man weiß es nicht. Dennoch bin ich nicht vollends von diesem Buch überzeugt: für eine echte fiktive historische Fortschreibung bleibt es zu vage, etwa wenn man es mit dem Roman von Robert Harris „Vaterland“ vergleicht, den Brussig ja auch noch selbst im Buch nennt. Für eine Autobiographie ist das Werk zu unrealistisch, d.h. man kann zu wenig zuordnen, was denn Brussig nun wirklich widerfahren ist – immerhin studierte und veröffentlichte er vornehmlich in Nachwendezeiten. Als kleines Bisschen aus allem ist es mir dann einfach zu lang und phasenweise auch zu langweilig: Das Familienleben der Brussigs, das Sammeln neuer Ideen für einen Roman, das Entstehen desselben, das ist einfach auf Dauer und über die Jahre nicht wirklich spannend. Und als tatsächlich fiktive Autobiographie ist es nicht interessant genug. Doch wenn Brussig am Ende des Romans seine Utopie tatsächlich einmal weiterzuspinnen beginnt, also die Systemfrage stellt, Freiheit gegen Zufriedenheit antreten lässt, da hätte sich noch massives Potential für das Werk ergeben, das Brussig aber im leeren Raum hängen lässt und der Phantasie des Lesers überlässt. Schade eigentlich. Die Lektüre ist unterhaltsam, das schon, aber ein richtig guter Roman ist es nicht.
geschrieben am 29.05.2015 | 656 Wörter | 3816 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen