Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Henker und Opfer
| ISBN | 388221726X | |
| Autor | Georges Bataille | |
| Verlag | Matthes & Seitz Berlin | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 92 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | broschierte Ausgabe |
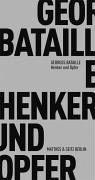
Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
In der ersten Folge von »Der Pfahl« ist ein Photo von Georges Bataille abgedruckt. Es stammt aus der Zeit um 1943. Das Portrait erinnert an ein anderes. An das eines anderen, eines deutschen Schriftstellers. Das berühmte Photo Ernst Jüngers, das 1942 in Paris aufgenommen wurde, zeigt dieselbe Physiognomie, denselben Gesichtsausdruck voller Intelligenz, Sensibilität und dem Leiden an dem Geschehen der Epoche. Tatsächlich reichen die Parallelen der beiden tief. Vielleicht könnte man gar Bataille als den französischen Ernst Jünger bezeichnen.
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Das »Jahrbuch aus dem Niemandsland zwischen Kunst und Wissenschaft« erschien 1987 und gilt heute als legendär. Es wird Antiquaren aus den Händen gerissen. Die erste Nummer insbesondere. Sie sprach allem aufgeklärten Zeitgeist in den 80ern Hohn. Provokation. Über 500 Seiten hatten Gewicht und Weckwirkung eines Ziegelsteins. Der offenbarte das allgemeine Bussi-Bussi der seichten Moral. Was sollte der westdeutsche Gymnasiallehrer damit anfangen?
Axel Matthes placierte das Portrait direkt hinter den kurzen und intensiven Text von André Masson über den Pariser Dandydenker Bataille, der von 1922 bis 1942 Bibliothekar an der Bibliothèque Nationale war. Masson diagnostizierte darin dem modernen Menschen einen »kranken Geist«:.»Er heiligt das Profane – sucht verschämt nach Ersatzformen für die Religion – und, sofern er Platz in einer militarisierten Herde gefunden hat, verschreibt er sich mit Leib und Seele dem Anführer, der ihm eine lächerliche Moral mit dem Knüppel einbläut.« Harte Worte.
Dem allgemeinen Sich-Preisgeben widerstrebten einzelne Ausnahme-Persönlichkeiten. Eine von ihnen sei Georges Bataille. Ohne auf das Moralin der Moral zurückzugreifen, so Masson, »findet er die Abhilfe für unsere intellektuellen, ästhetischen und sozialen Duckmäusereien in der Betrachtung unserer Abgründe«. Dieses Bekenntnis zu seinem Kollegen erschien 1958 in La cigue.
Es ist nun von Matthes & Seitz Berlin in dem kleinen Essay-Band »Henker und Opfer« neu herausgegeben worden. Der Verlag fasste Essays von Georges Bataille zusammen, die im Original in Zeitschriften in Frankreich in den 40er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts erschienen waren. In Deutsch wurden sie alle in verschiedenen Ausgaben des »Pfahls« in den 80er und 90er Jahren publiziert. Sie alle beschäftigen sich thematisch mit dem Grauen. Mit dem, was Menschen bereit und fähig sind, Menschen anzutun. Für Bataille war daran nicht so sehr das Bestehen von Schmerz und Bösem in der Welt das Besorgniserregende. Denn dagegen wäre innerhalb der Menschheitsgeschichte ja Besserung denkbar. Nein. Das Schlimmste an diesem weltweiten Schmerz sei, dass er von anderen gewollt sei.
Ähnlich wie Hannah Arendt versuchte auch der 1962 verstorbene Bataille, die Kategorien von Schmerz, Verletzung und bewusst beigebrachtem Leid ohne moralische Wertungen, mithin ohne Schuldzuweisung zu untersuchen. Und damit wirklich zu analysieren. »Wir können nicht MENSCHLICH sein, ohne in uns die Fähigkeit zum Schmerz, auch die zur Gemeinheit wahrgenommen zu haben. Aber wir sind nicht nur die möglichen Henker der Opfer: die Henker sind unseresgleichen. Wir müssen uns auch noch fragen: Gibt es nichts in unserem Wesen, das so viel Entsetzen möglich macht? Und wir müssen uns wohl zur Antwort geben: Tatsächlich, es gibt nichts.«
geschrieben am 29.05.2008 | 483 Wörter | 2902 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen