Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Riten der Selbstauflösung
| ISBN | 3882215003 | |
| Autor | Verena von der Heyden-Rynsch | |
| Verlag | Matthes & Seitz Berlin | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 328 | |
| Erscheinungsjahr | 2001 | |
| Extras | - |
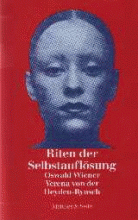
Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
Jede – scheinbare – Erleichterung im Leben des Menschen ist teuer erkauft. Technischer Fortschritt, wissenschaftliche Erkenntnisse, ökonomische Zentralisierung oder die Entwicklung der Menschenrechte sind trojanische Pferde. Erleichterung und Abhängigkeit sind die zwei Seiten des Fortschritts. Früher war das Dasein beschwerlicher. Die Arbeit war körperlich wesentlich anstrengender, etwas zu produzieren dauerte viel länger und kostete mehr menschliche Kraft. Zu sagen hatten die meisten Menschen nichts. Es herrschten wenige über die vielen Namenlosen. Heute ist alles ganz anders.
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Heute dürfen wir alle mitbestimmen. In jedem Betrieb gibt es einen Betriebsrat. Regelmäßig sind wir als Teil des demokratischen Souveräns aufgerufen, unsere Volksvertreter zu bestimmen. Der allgemeine Wohlstand hat sich zweifellos erheblich gesteigert. Doch abgesehen von der – schwierigen – Frage, was wir wirklich mitzuentscheiden haben, ist eines zu konzedieren: Jegliche Weiterentwicklung hat ihren Preis.
Aus der globalisierten Weltwirtschaft hat niemand mehr die Möglichkeit, auszusteigen. In einer vollständig überwachten Angestelltengesellschaft hat niemand mehr die Chance, ein klein wenig den Fiskus hinters Licht zu führen. Die deutschen Finanzämter haben unbegrenzten Zugriff auf alle Konten. Das Bankgeheimnis ist in Deutschland abgeschafft. Waren noch vor einigen Jahrzehnten gewisse Regelverstöße eher Kavaliersdelikte, so gibt es jetzt kein Entrinnen mehr. Der elfte September dient als Vorwand, die letzten Fetzen von Datenschutz restlos zu beseitigen. Grundsätze des Rechtsstaates werden in Frage gestellt. Verschiedenste Dienste durchleuchten unsere Computer. Die Reihe ließe sich fortsetzen.
Mit zunehmender Modernisierung einher geht ein Verlust an mentaler Selbstbestimmung. Für uns wird gedacht. Der Rahmen, in dem ich überhaupt agieren darf, wird immer enger gesteckt. Wer nicht für die etablierten Parteien stimmt, ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Es gibt seit dem Ende des 18. Jahrhunderts einen Typus, der diese Entwicklung an sich selbst idiosynkratisch spürte. Er setzte sich eine Maske auf, die von den meisten noch nicht einmal als solche erkannt wurde: Der Dandy. Entgegen landläufiger Meinung ist conditio sine qua non des Dandys nicht seine besondere, edle Kleidung. Der Ur-Dandy Brummell nutzte sie, weil die Bedeutung der Mode zu seiner, der Regency-Periode besonders groß war. Dandyistisch dagegen ist ein Herausgehen aus dem etablierten Milieu und gleichzeitig ein Dabeibleiben. Die Kunst des Dandys ist es, die Regeln zu verletzen, die er grundsätzlich achtet. Er verletzt sie punktuell, ohne sie in toto zu brechen. Hierin erkennt er das größere Sprengpotential. Er ist kein Anarchist, dagegen der Anarch nach Ernst Jünger, wie der ihn in »Eumeswil« beschreibt. Der Dandy ist der Einsame, der sich seines Wertes bewusst ist. Er ist der Mönch in der Zelle, der diese Entscheidung mit vollem Bewusstsein getroffen hat. Er macht sich nicht eins. Daher nähert sich der Mensch in bestimmten Tätigkeiten dem dandyistischen Seinszustand an: beim stillen Gebet in einer mittelalterlichen Kirche, bei der Kontemplation über die Fragen, die den Sinn seines Seins streifen, beim Eins-Sein mit seiner Bibliothek. Walter Benjamin sah Ähnliches beim sich wahrnehmenden Flaneur durch die moderne, überfüllte Großstadt. Der Dandy ist auf der Welt im Bewusstsein des Endes seiner Zeitskala. Darüber braucht man mit ihm nicht zu diskutieren. Er sieht sich als Zeit-Gast. Da er mit jeder Herrschaft über sich unzufrieden wäre, hegt er nicht mehr das Ziel auf Veränderungen. Das erhöht seine Freiheit ungeheuer. Jünger sehr übel genommen worden ist seine literarische Aussage, der Anarch gehe durch die historische Folge von Regimen hindurch wie durch einen Säulengang. Möglichst ohne anzustoßen. Als Argument auf seiner Seite steht, dass sich im vorigen Jahrhundert die Ideologien erschöpft haben. Stellvertretend für die Menschheit ist er des Engagements müde. Wofür?
Die von Verena von der Heyden-Rynsch herausgegebenen »Riten der Selbstauflösung« stellen sich diesen Kontexten, Fragen, Wunden. Das Dandyistische als einer unter verschiedenen möglichen Riten eines Herausgehens aus dem von der Umwelt Berechenbaren. Die Freiheit des Dandys ist ja gerade ermessen im Umfang seiner Unberechenbarkeit. War das nun wieder Ironie? Oder hat er es ernst gemeint? Die allgemeine Sinnleere scheint offenbarer zu werden und damit dieses Buch immer aktueller werden zu lassen. Immerhin ist die erste Ausgabe vor nun einem Vierteljahrhundert erschienen. Erstaunlicherweise blieb es in dieser gesamten Zeit im Gespräch. Nicht im intellektuellen Kanon. Aber in bestimmten, geistig anspruchsvollen Kreisen war es niemals verschwunden.
Die knapp drei Dutzend Beiträge dieser Anthologie haben eine Art untergründiger, tiefer Verbindung miteinander. Immer geht es um das andersartige Leben, um ein bewusstes Herausgehen aus den von der Gesellschaft erwarteten Verhaltensweisen. Insoweit ist der Punk dem Dandy näher als der Angestellte. Dass der Begriff des Dandys geistig zu fassen ist und nicht modisch, macht Oswald Wiener in seinem vollendeten Bruchstück, das vielleicht das Herz, das innere Zentrum des Buches darstellt, unmissverständlich klar. Unversöhnlich schreibt Wiener: »der dandy ist genauer, empfindlicher, in den formen seiner gesellschaft idiosynkratischer beobachter seiner inneren und äusseren umgebung […]. er hat verstanden dass seine ergriffenheiten internen gesetzmässigkeiten folgen und ihm demnach vorgezwungen sind. entdeckt die mechanik immer grösserer teile dessen, das er für seine freiheit gehalten hat, bis hin zum apparat der verzweiflung. wo ist ich? alle ihn erschütternden werte fügen sich in eine konstruktion, welche hebel zeigt sie in abstand zu bringen – der dandy befindet sich auf einer spirale nach innen, von allem bewusst gewordenen zieht er den sinn ab in sich hinein: das bist nicht du.«
Andy Warhol war vielleicht der Künstler des 20. Jahrhunderts, der die Moderne am konsequentesten darstellte. In einem der legendären Interviews, das in dem Band abgedruckt ist, sagt er. »Es ist schwer, schöpferisch zu sein, und es ist auch schwer, nicht zu glauben, daß, was man tut, schöpferisch ist, und schwer, nicht schöpferisch genannt zu werden, weil jedermann beständig darüber redet und über Individualität. Jedermann ist immer schöpferisch. Und es ist so komisch, wenn man sagt, die Dinge seien es nicht, so als wenn man den Schuh, den ich für eine Anzeige zeichnete, eine ‚Schöpfung’ nennte, nicht aber die Zeichnung des Schuhs. Doch ich denke, daß ich an beide Arten glaube. Alle diese Leute, die nicht sehr gut sind, sollten wirklich gut sein. Gegenwärtig ist jeder wirklich zu gut. Beispielsweise, wie viele Schauspieler gibt es? Es gibt Millionen Schauspieler. Sie sind alle ziemlich gut…«
Eine furiose Anthologie, lange Jahre nicht lieferbar, die nun vom Matthes & Seitz Verlag neu aufgelegt wurde. Ein wahrhaft dandyistisches Buch. Eine der geistigen Fundgruben fĂĽr die entstehende Sekte der Nachwuchsdandys.
Vom hohen Blickwinkel: How to be a dandy?
geschrieben am 12.04.2007 | 1026 Wörter | 6179 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen