Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Love and Death in Lawrence and Foucault
| ISBN | 0820495409 | |
| Autor | Barry Scherr | |
| Verlag | Peter Lang Verlagsgruppe | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 406 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | - |
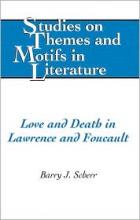
Rezension von
Hiram Kümper
Dieses Buch ist keine literaturwissenschaftliche Studie im engeren Sinne. Man wird vielleicht sogar fragen können, ob es ĂŒberhaupt eine ist. Die Selbstbeschreibung auf dem BuchrĂŒcken nennt es âthe first full-length study of Foucault and the Foucaultians not to look at them from a quasi-hagiographical perspective.â
weitere Rezensionen von Hiram KĂŒmper

Nun könnte man natĂŒrlich einwenden, dass â trotz aller Heldenverehrung gegenĂŒber Foucault, die ja in der Tat eine betrĂ€chtliche Literatur hervorgebracht hat â dies durchaus nicht die erste kritische Auseinandersetzung in buchlanger Form sei. Man könnte einwenden, dass der Verweis auf die âquasi-hagiographischeâ Affirmation Foucaults mittlerweile selbst ein ziemlich abgedroschener Topos geworden ist. Man könnte auch fragen, wer diese âFoucaultiansâ seien, auf die doch ganz sicher nicht der âquasi-â, oder besser mĂŒsste man dann ja âsekundĂ€r-quasi-hagiographischeâ Blick gerichtet wird. Man kann das alles aber auch unterlassen. Denn es ist ganz offenkundig, dass der Verfasser an solcherlei kritischer Auseinandersetzung wenig Interesse haben wĂŒrde.
Scherr hat es sich zum Ziel gesetzt, âD.H. Lawrence to his rightfully and supremely high place in the pantheon of great British literatureâ zurĂŒck zu verhelfen. Auch hier erlaube ich mir ein Zitat des Klappentextes, weil es Scherr an keiner Stelle im Buch selbst fĂŒr nötig erachtet, sein Anliegen, sein Vorgehen und seine PrĂ€missen deutlich darzulegen.
Stattdessen beginnt das Buch mit einem Kapitel zu 09/11. Hier wird auch deutlich, worum es Scherr noch, vielleicht sogar in erster Linie, geht: um âWestern civilizationâ â eine Wendung, die auffĂ€llig hĂ€ufig durch das gesamte Buch hindurch fĂ€llt. Die also ist in Gefahr und der zentrale Feind ist: âdiversityâ â ein ZugestĂ€ndnis an einen Multikulturalismus, der âdenigrates the creative-artistic power of Western civilizationâs greatest figures in favor of the social-political power of âgroups, defined largely in terms of race, ethnicity, sex, and sexual preference.ââ (S. 2). Das ist also, Scherr zufolge, das Dilemma. Und wer ist schuld? Foucault.
Befremdlich erscheinen vor allem die wiederholten Angriffe gegen die âClitonesque trendy left-wing obliviousness/appeasement/valorization of Third World terroristsâ (S. 1), die ewig zitierte âleft-wing political correctnessâ (S. 2) oder â ganz besonders befremdlich â gegen âthe grotesquely enormous amount of taxpayer money spent in the Untied States to fight AIDS (more than that spent on all other diseases combined!), and the grotesquely unjust and unproductive regime of reverse discrimination that (since 1978) dominates the âspecificâ domain of literary-cultural-political academia, where a white heterosexual male (especially if he is politically incorrect) has as much chance of getting a fair deal as a rabbi has of becoming the head of Saudi Arabiaâ (S. 3). Hier ist âcommitedâ (oder, wie es im Klappentext heiĂt: âcourageousâ) schon nicht mehr der richtige Ausdruck fĂŒr das, was als vorgeblich literatur-, philosophie- oder jedenfalls geisteswissenschaftliche Studie daherkommt; hier wird nicht mehr nur polemisiert, hier wird propagiert. Gerade der letztzitierte Absatz schlieĂt sich bruch- und nahtlos an eine Collage Foucaultscher Zitate zur Möglichkeit Homosexueller, staatliche Anerkennung zu erlangen, an. Diese Gleichsetzung von AIDS und HomosexualitĂ€t ist so verbohrt, dass man bereits (oder spĂ€testens?) hier â notabene: auf Seite 3! â das Buch am liebsten weglegen möchte. Die ĂŒble Laune des Verfassers und der Hass gegenĂŒber Foucault und der sehr unkonturiert aufgeworfenen Gruppe der âFoucaultiansâ (wer immer das sei), die aus jedem Kapitel sprechen, macht die LektĂŒre in der Tat zu einem anstrengenden Unterfangen.
Im besten Falle ânurâ anstrengend sind Scherrs AusfĂ€lle gegenĂŒber anderen â man hat in gewisser Weise Probleme, sie als âKolleginnen und Kollegenâ zu titulieren â, wie etwa Henry Louis Gates, der als âbogus, pretentious shamâ (S. 251) beschimpft wird. Anstrengend ist auch seine Arbeitsweise mit ausgiebigen Langzitaten, die dann noch einmal paraphrasiert werden.
Was nun hat aber jetzt D. H. Lawrence damit zu tun? Die Frage ist berechtigt und ob die vorliegende Arbeit sie wirklich beantwortet, darĂŒber kann man geteilter Meinung sein. Auf Seite 12 jedenfalls, nach ausgiebigen Tiraden ĂŒber das US-amerikanische UniversitĂ€tssystem und die Krise der westlichen Zivilisation âthat indeed reached its peak on September 11, 2001â (ebd.), kommt der â jedenfalls fĂŒr den Rezensenten reichlich unvermittelte â Anschluss: âBut indeed there is another â9/11â that in its own way is just as crucial for the fate of Western civilization: September 11, 1885â â der Geburtstag von D.H. Lawrence also. Der zentrale Punkt, den Scherr im Folgenden aufmacht und ĂŒber vier weitere Kapitel weiter ausbaut, ist der: WĂ€hrend Foucault das Individuum im Wesentlichen als âraw materialâ von Machtoperationen sĂ€he, habe Lawrence einen positiv besetzten, aktivischen IndividualitĂ€tsbegriff konturiert, der formend mit der sozialen und politischen Welt umgehen können. Das ist Scherr offensichtlich sympathischer und nur an einem solchen Individuum, so der Argumentationsgang, könne das westzivilisiert Wesen genesen.
Das zweite Kapitel unternimmt eine ausgiebige âLawrentian Critique of Foucaultâ, an das sich eine âLawrention Solutionâ fĂŒr das Problem sozialer und sexueller Bindung anschlieĂt. Wie schön, dass es noch Arbeiten gibt, die den expliziten Anspruch haben, Probleme zu lösen! Ob die hier angebotene (von âAngebotâ kann man angesichts der apodiktischen Behandlung des Themas freilich kaum mehr sprechen) eine ist, mag der Leser entscheiden. Die sehr selektiven Foucault-LektĂŒren und deren suggestive Interpretation dĂŒrften auch zu Widerspruch angetan sein. Es folgt eine âLawrentian Noteâ von lediglich vier Seiten zum Problem des Todes bei Foucault und eine etwas ausfĂŒhrlichere Auseinandersetzung mit dem Foucaultâschen Machtbegriff. Die Arbeit schlieĂt mit einem reichlich unglĂŒcklich als âConclusionâ betitelten sechsten Kapitel, das mit ĂŒber 100 Seiten (!) ein gutes Drittel der gesamten Studie einnimmt.
Auch hier schlĂ€gt dem Leser auf beinahe jeder Seite die Verachtung des Verfassers entgegen, beispielsweise wenn er Lawrences Tiraden gegen Homosexuelle nicht nur vollkommen unkommentiert referiert, sondern ihm sogar dafĂŒr noch einen âstrong moral senseâ attestiert â selbst, wenn âLawrence in his last days came to view homosexuality as only a synecdoche [!!!] of the âsickâ aspect of an âinsidious(ly) disease(d)â Western civilization in decline â in decline due not only [!!!] to homosexuality, but also to the myriad other aspects of corrupt elite left-wing âcivilisationââ (S. 325). Mehr solcher Zitate scheinen mir nicht nötig. Und rĂŒckblickend scheint mir das nicht nur fĂŒr die Zitate zu gelten.
Eines kann man diesem Buch ganz sicher in Anschluss an die Selbstbeschreibung des Buchdeckels attestierten: es ist âutterly uniqueâ. Und ich möchte dazufĂŒgen: das ist auch gut so! Mehr solche BĂŒcher werden wirklich nicht gebraucht.
geschrieben am 23.11.2009 | 1017 Wörter | 6261 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen