Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
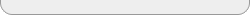
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Silver Surfer: Requiem
| ISBN | 3741604003 | |
| Autoren | J. M. Straczynski , Esad Ribic | |
| Verlag | Panini | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 104 | |
| Erscheinungsjahr | 2017 | |
| Extras | - |

Rezension von
Frank Drehmel
Im Jahre 1966 – die Beach Boys trällerten seit einigen Jahren vom Wellenreiten in den USA – erschuf Jack Kirby mit dem Silver Surfer eine der ikonischten Figuren des US-Maintream-Comics; so ikonisch, dass Gestalt und der tiefere Hintergrund dieses Charakters die Dekaden nahezu unverändert überdauerten: keine Spandex-Hose, deren Design den Wellen des Zeitgeistes folgte, keine moderne Grim'n'gritty-Attitüde; und ein tragischer Zug, eine innere Zerrissenheit, die den Gegenwarts-Helden von vielen heutigen Autoren in das Stammbuch geschrieben wird, wohnte der Figur schon bei ihrem ersten Auftritt vor mehr als 50 Jahren inne.
weitere Rezensionen von Frank Drehmel

Was liegt da näher – jedenfalls für einen um Erzählmaßstäbe ringenden Autoren wie Straczynski -, als das quasi-statische Moment dieser Figur durchbrechen zu wollen?! Statt den Surfer grasrauchend in Skaterhose mit Board und mp3/4-Player zu inszenieren, was zweifellos eine signifikante Neuschöpfung der Figur bedeutet hätte, lässt ihn das Mastermind hinter „Babylon 5“ – gelobt seist du, oh Autor! – ganz profan sterben, negiert das Leben, das Immer-schon-irgendwie-zum-Marvel-Kosmos-gehört-haben, durch den Tod des silbernen Wellenreiters. Von 1 auf 0 in 104 Seiten; ein langsamer, pathostriefender Prozess.
Doch beginnen wir am Anfang: am Anfang schuf Galactus einen Herold, der für ihn essbare Planeten suchen und finden sollte. Zu diesem Zwecke stattet er Norrin Radd – so der bürgerliche Name des Surfers auf seiner Heimatwelt Zenn-La – mit kosmischen Kräften und einer dekorativen silbernen Haut aus, die es dem Angestellten erlaubte, durch das Universum zu tuckern, respektive surfen. Die ständige Reisetätigkeit durch kosmische Stürme, Leere und allerlei Unbill zeitigt nun allerdings Wirkung: des Surfers Macht verblasst, die schützende Haut wird fleckig und der Exitus ist unausweichlich. So tritt der Silberne seine letzte Reise an, die ihn zunächst zur Erde, seinem Lieblingsplaneten unter Myriaden anderer Welten, führt, wo ihm Reed Richards von den Fantastischen Vier sein Ende nochmals wissenschaftlich sauber bestätigt. Es bleibt sogar noch Zeit, sich von Spiderman zu verabschieden, um abschließend gen Zenn-La zu surfen, wo er im Kreises einer Lieben sanft zu entschlummern hofft. Und auch Galactus mach sich – erneut - auf den Weg nach Zenn-La.
So! Nun wissen wir es: auch der Silver Surfer kann sterben. Und es ist in dieser Story außerhalb der regulären Marvel-Kontinuität kein heldenhafter Kampfestod, sondern ein Dahinsiechen, ähnlich dem Krebs, der einst Jim Starlins Captain Marvel dahinraffte – und auch damals lungerten die Fantastischen Vier und Spidey am Sterbebett rum.
Da die Story nicht wirklich ergebnisoffen daherkommt, bedarf es schon einiger dramaturgischer Finesse, um den Leser bei der Stange zu halten. Diese Finesse lässt Straczynski allerdings vermissen. Die Handlung wirkt eng und klein, eines kosmischen Reisenden geradezu unwürdig. Der Fokus liegt eher auf den Figuren, denen der Surfer während seines Sterbens begegnet. Die Fantastischen Vier mag man trotz allen übertriebenen Pathos' noch als Reminiszenz an das Surfer-Debüt in „The Fantastic Four # 44“ tolerieren, aber der Spiderman-und-Mary-Jane-Subplot erscheint so deplatziert wie Dr. Stranges Cameo-Auftritt.
Esad Ribics malerisches Artwork hinterlässt einen ambivalenten Eindruck. Nicht nur, dass ab und an der Einsatz seines Grafik-Programms künstlich-hölzern durchscheint, sondern den weichen, pastellenen Bildern fehlt es generell auch an Hell-Dunkel-Kontrasten, sodass viele Szenen gleichsam hinter einem dunstigen Schleier verschwimmen. Auf der Habenseite hingegen findet sich seine grafische Interpretation des Silbernen, die durch Eleganz, Dynamik und insbesondere die unterm Strich gelungene Nichtmetall-Metall-Darstellung der Haut besticht, während bei anderen Protagonisten hin und wieder die Proportionen verrutschen.
Fazit: Die vorhersehbare, unoriginelle, pathostriefende Story sowie das alles in allem zu blasse Artwork machen Requiem zu keinen Meilenstein bzw. wĂĽrdigen Grabmonument in der Surfer-Historie.
geschrieben am 18.02.2018 | 566 Wörter | 3548 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen