Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1949-1990
| ISBN | 3406521711 | |
| Autor | Hans-Ulrich Wehler | |
| Verlag | C.H.Beck | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 529 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | - |
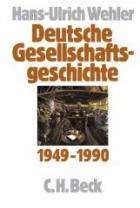
Rezension von
Jan Robert Weber
Über Hans-Ulrich Wehlers fünften und letzten Band der Deutschen Gesellschaftsgeschichte ist bereits viel geschrieben worden. Als streitfreudiger Historiker musste er sich ebenso viel Kritik gefallen lassen. Nicht zuletzt, weil der Bielefelder Emeritus zahlreiche historiographische Debatten, von der Fischer-Kontroverse über den Historiker-Streit bis zu Goldhagen, im Kapitel über die neue „Politische Kultur“ der Bundesrepublik mit spitzer Feder beschrieben hat und dabei manchen Kollegen alt aussehen lässt. Tatsächlich ist der abschließende Band „Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1949-1990. Bundesrepublik Deutschland und DDR“ ein Standardwerk der deutschen Zeitgeschichtsschreibung, das seinen Leser pointiert und urteilssicher den Erfolg der Bundesrepublik und das Scheitern der DDR vor Augen führt.
weitere Rezensionen von Jan Robert Weber

Wie alle anderen Bände ist auch der jüngste Teil gegliedert: Den Auftakt bilden die „politischen Rahmenbedingungen“, gefolgt von den „Turbulenzen der Bevölkerungsgeschichte“. Das dritte Kapitel ist den „wirtschaftlichen Entwicklungsprozessen“ gewidmet, während der vierte Abschnitt der Thematisierung der „sozialen Ungleichheit“ vorbehalten ist, der im fünften die Strukturanalyse „politischer Herrschaft“ und schließlich im sechsten die „Strukturbedingungen und Entwicklungsprozesse der Kultur“ folgen.
Die gesellschaftsgeschichtliche Bestandsaufnahme der zweiten Hälfte des „kurzen 20. Jahrhunderts“ in Deutschland ist erfrischend klar geschrieben und eindeutig in ihren Bewertungen. So muss, entgegen allen kritischen Rezensenten, festgestellt werden, dass endlich ein deutscher Historiker den Mut bewiesen hat, der DDR als einer „sowjetischen Satrapie“ den ihr gebührenden Rang zuzuweisen. Als politisch, kulturell wie sozial kollabierter und damit kurzlebiger Satellitenstaat der Sowjetunion wertet Wehler ihre historische Existenz als eine „Sackgasse“ der deutschen Geschichte, die dementsprechend am Ende der einzelnen Kapitel kurz und bündig abgehandelt wird. Die DDR erscheint als das, was sie de facto ist: eine Altlast. „Alle falschen Weichenstellungen“ des DDR-Regimes müssten, so Wehler, „bis heute nach dem Vorbild des westdeutschen Modells in einem mühseligen Prozess korrigiert werden. Das ist die Bürde der neuen Bundesrepublik seit 1990.“
Erfrischend ist auch die Bewertung der frühen bundesrepublikanischen Geschichte als einer Erfolgsstory, die keineswegs nur vom wirtschaftlichen Aufschwung, sondern auch von einem paradigmatischen Wandel der politischen Kultur erzählt. Dabei fällt Wehler abgewogene Urteile, mit denen die häufig geübte Rede von einer vermeintlichen Restauration überzeugend als verfehlte Polemik entlarvt wird. So legt Wehler dar, dass die Weichenstellungen der Adenauer-Regierung für den demokratischen Rechtsstaat, die Westintegration und den marktwirtschaftlich orientierten Sozialstaat zu einer rasanten und nachhaltigen Demokratisierung nicht nur des Staatsgefüges, sondern auch der bundesdeutschen Gesellschaft führte. Innerhalb von rund 14 Jahren gelang dem christdemokratischen Kanzler das, was im vergleichbaren Zeitraum den Demokraten der Weimarer Republik misslungen war, nämlich die Deutschen vom Demokratieprinzip zu überzeugen. Wehler weist diesen grundlegenden politischen Mentalitäts- und Gesinnungswandel anhand demoskopischer Umfrageergebnisse nach: 1951 beurteilten 2% (!) der Bundesbürger die Demokratie als positiv, zwei Jahre später waren es bereits 42% und gegen Ende der Adenauer-Regierung, im Jahr 1962, votierte eine knappe Zweidrittelmehrheit von 62% für das westdeutsche Modell. Nicht einmal eine Generationsspanne war also nötig, um das antidemokratische Denken und Fühlen der Mehrheit in eine liberal-demokratische Überzeugung umzuwandeln. Die vielstimmige Kritik an Wehler erklärt sich zumindest teilweise aus dieser nüchternen Interpretation: Die Adenauer-Ära war keine Epoche der Restauration (von was eigentlich: NS-Staat, Weimarer Republik, Kaiserreich?), sondern die Ära des entscheidenden demokratischen Identitätswandels der Deutschen! Neben dem wirtschaftlichen Aufschwung wurde zwischen 1949 und 1969 „ein politischer Modernisierungsprozess mit dem Ziel“ vorangetrieben, „endlich die so lange gescheiterte Utopie der ‚Bürgerlichen Gesellschaft’ in der Gestalt einer modernen ‚Zivilgesellschaft’ zu verwirklichen.“
Da Wehler die großen Linien der bundesdeutschen Geschichte stets im Auge behält, lösen sich manche liebgewonnene Erzählmuster wie von selbst auf. So erfährt beispielsweise das oft künstlich hochgespielte Thema der Integration der NS-belasteten Beamtenschaft eine angemessene Gewichtung. Adenauers personalpolitischer Kurs, Erfahrung und Sachverstand höher zu schätzen als vormalige Gesinnung, würdigt Wehler überzeugend als „Pragmatismus“, der zwar vergangenheitspolitisch bedenklich stimme, für die Konsolidierung der Bundesrepublik, den Aufstieg Westdeutschlands wie „Phönix aus der Asche“, aber von großer Bedeutung gewesen sei. Die frühe „Konsolidierung des Beamtenapparats“ gewährleistete, so Wehler, in „turbulenten Zeiten“ die notwendige „Effizienz der Verwaltung bei der Bewältigung der drängenden Probleme“ in der Sozial- und Wirtschaftspolitik.
Mehr noch dürfte Wehlers Bewertung der 68er-Bewegung als einem „legendenumrankten Phänomen“ viele seiner Rezensenten zu kritischen Stellungnahmen veranlasst haben. Von einem „Usprungsmythos“ der bundesdeutschen Demokratie will Wehler denn auch nichts wissen. Denn von wenigen Ausnahmen abgesehen, sei an dieser „heroischen Verklärung“ nichts richtig. Alle wichtigen Reformen in Politik und Kultur, Wirtschaft und Soziales hätten vor und ohne die 68er-Bewegung stattgefunden. Das ist schon insofern überzeugend, als jeder Skeptiker diese einfache, aber schlagende These mit einem Blick in den Ploetz nachprüfen kann. Tatsächlich attestiert Wehler der 68er-Revolte mit ihrer Verehrung von Ho Tschi Minh und Che Guevara, ihrer „neomarxistischen Theoriebesessenheit“ und Zustimmung zur chinesischen Kulturrevolution, während der 16 Millionen Menschen umgebracht wurden, „Züge eines pubertären Überschwangs“, die auch den überzogenen Protest gegen die Notstandsgesetze kennzeichneten. Denn mit den Notstandsgesetzen der Großen Koalition wurde nicht das Ende der Demokratie bzw. der Beginn eines faschistischen Regimes eingeläutet, wie es die Aktivisten damals „effektiv perhorreszierten“, sondern ein rechtsstaatliches Instrumentarium für den Krisenfall. Nicht zuletzt beurteilt der Bielefelder Emeritus die bildungspolitischen Bestrebungen der 68er nach einer vermeintlichen Demokratisierung der Universität als eine bis heute nachwirkende Beschädigung von Schule und Hochschule, die im Agieren gegen den angeblichen Leistungsterror am wirkungsvollsten ausfiel. Wehler hat das Kapitel über die 68er mit der Frage „Triumph oder Debakel?“ überschrieben; sein Resümee ließe sich mit einem „Viel Lärm um wenig Gutes“ zusammenfassen. Wegen ihrer Realitätsfremdheit, einer Politischen Romantik von links, leisteten sie, so Wehler, nicht einmal indirekt einen entscheidenden Beitrag zur Demokratisierung der bundesdeutschen Gesellschaft. Jugendkultur, Frauenemanzipation, Ökologisierung und Bildungsreformen – all diese mit 68 etikettierten Felder haben die 68er nur unterstützt, nicht aber hervorgebracht. Sie halfen, „Restbestände obrigkeitsstaatlichen Denkens“ abzubauen. Und sie „veränderten über kurz oder lang den Lebensstil in einigen sozialen Klassen“. Insgesamt versteht Wehler die 68er-Bewegung dialektisch als ein ambivalentes Phänomen: Es habe sich um eine „unfreiwillige Avantgarde der kapitalistisch organisierten Konsumgesellschaft“ gehandelt, die „sie durch ihren krassen Hedonismus und Individualismus […] vorantrieb, so dass ihr politisches Scheitern zugleich einen Erfolg der von ihnen ebenfalls verkörperten ‚Lebensstilrevolution’ darstellte“. Kurzum: Die 68er-Revolte schuf „freie Bahn für den Individualisierungsdrang im Verein mit einem unbeschwerten Lebens- und Konsumgenuss“ und arbeitete damit dem verhassten Kapitalismus in die Hände.
Die Integration dieser neo-marxistischen Revoltierer ist der Bundesrepublik Deutschland trotz der Bewährungsprobe, vor die sie die RAF stellte, gelungen, was Wehler als ein weiteres Indiz für die Erfolgsgeschichte Deutschlands nach 1945 darstellt, die schließlich in der deutschen Einheit von 1989/1990 gipfeln lässt. Allerdings sei abschließend noch ein Aspekt des fünften Bandes der „Deutschen Gesellschaftsgeschichte“ in diesem Zusammenhang hervorgehoben. Im Gegensatz zu manch anderen Zeithistorikern ist für Wehler mit der Wiedervereinigung kein „rundum befriedigender Endzustand“ erreicht. Im Einleitungs- wie im Schlusskapitel schlüpft der Gesellschaftshistoriker daher in die Rolle des rückwärts gewandten Propheten und liest der Gegenwart die Leviten. Zwar sei Deutschland mit der Bundesrepublik von seinem nationalistisch-autoritären Sonderweg innerhalb des westlichen Kulturkreises abgewichen, mittlerweile stellten sich aber neue Herausforderungen. Ihre Bewältigung skizziert Wehler wie folgt: So soll etwa die „Sprengkraft des neuen Subproletariats“, gemeint sind Migranten, durch eine „gezielte Integrationspolitik entschärft werden“; so soll in den Bildungssektor wieder wie gegen Ende der 1960er Jahre großzügig investiert werden; so soll „die Macht der Großunternehmen […] gezähmt werden“. Und schließlich müsse der „internationale Turbokapitalismus der Globalisierung, die kein unkorrigierbares, übermächtiges Fatum verkörpert, […] so eingehegt werden, wie der naturwüchsige Privatkapitalismus des 19. und 20. Jahrhunderts durch den Sozial-, Rechts- und Verfassungsstaat zivilisiert worden ist.“ All das könne nur ein starker, keinesfalls schlanker Staat leisten. Damit gehört der – streitbare – fünfte Band der „Deutschen Gesellschaftsgeschichte“ nicht nur in die Hände von (angehenden) Historikern, sondern sei auch allen empfohlen, die für die Politik von heute und morgen das nötige historische Grundwissen benötigen.
geschrieben am 02.11.2008 | 1243 Wörter | 9008 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen