Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Der Dandy. Wie er wurde, was er war. Eine Anthologie
| ISBN | 3412200220 | |
| Autor | Melanie Grundmann | |
| Verlag | Böhlau | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 200 | |
| Erscheinungsjahr | 2007 | |
| Extras | gebundene Ausgabe |
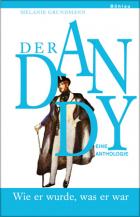
Rezension von
Daniel Bigalke
Angesichts einer zunehmenden Standardisierung der Verhaltensweisen, einer VerdrĂ€ngung transzendenzbezogener Lebensweisen und der Erschleichung sozialer Bindung durch strenge staatliche BĂŒrokratien, was letztendlich die Reduktion des Individuums-auĂerhalb-der-Welt zum immer nur suchenden Individuum-in-der-Welt hervorbrachte, ist es nur eine Frage der Zeit, daĂ sich alternative LebensentwĂŒrfe entwickeln. Die Auseinandersetzung mit diesem Zustand moderner Gesellschaften absolvierte Karl Jaspers (1883-1969) mit seinem Ausdruck âApparatâ, JosĂ© Ortega y Gasset (1883-1955) mit dem Begriff der âMassengesellschaftâ oder Arnold Toynbee (1889-1975) mit dem Terminus âununterscheidbarer Zustandâ. Spengler nannte dieses Stadium der Kultur âZivilisationâ. Es gibt keine dem System und den in es eingepaĂten Menschen vorausgehende GĂŒltigkeitsbasis mehr. Es fehlen, mit Arnold Gehlen zu reden, die haltgebenden Prinzipien, die der Gefahr ausgeliefert sind, âauf jenes Minimum an AuĂenbestĂ€tigung verzichten zu mĂŒssen, ohne daĂ er [der Mensch, d. Verf.] auf die Dauer nicht leben kann.â Es ist das Industriesystem in der 2. HĂ€lfte des 20. Jahrhunderts - ein System aus zweiter Hand, dessen naturwissenschaftlich-mechanistisches Denken die Verantwortung fĂŒr diese dialektische Reduzierung von Kultur zu tragen scheint.
weitere Rezensionen von Daniel Bigalke

Der soziale Typus des Dandys war der individuelle Versuch Einzelner, durch ihre oppositionelle Lebensweise in Kombination mit einem betriebenen Selbstkult jene Verwerfungen der AuĂenwelt zu ĂŒberwinden, um in ihr wĂŒrdig zu leben. In der umfangreichen Literatur zum Dandyismus gibt es wenige Texte, die bis heute die Definitionsgrundlage bilden. Der wichtigste zur Theorie des Dandyismus ist das Unterkapitel Der Dandy in der Studie ĂŒber den Maler Constantin Guys, die Charles Baudelaire 1863 verfasst hat. Bis heute unĂŒbertroffen ist Der moderne Dandy. Ein Kulturproblem des 19. Jahrhunderts von Otto Mann, der damit 1924 bei Karl Jaspers promovierte. Auch hier zeigt sich Jaspers SensibilitĂ€t fĂŒr Fragen der aristokratischen GroĂmĂŒtigkeit in Phasen der âdĂ©cadenceâ.
Das nun im Böhlau-Verlag vorliegende Werk von Melanie Grundmann vereinigt zum ersten Mal ĂŒbersichtlich und gut lesbar originale Kerntexte zum Thema âDandyismusâ. Dazu zĂ€hlen das âTagebuch eines modernen Dandyâ von 1818, verfaĂt im England unter George IV. Weiterhin findet der Leser die Analyse âDer Mann von Weltâ (1815) aus Frankreich, wo ĂŒber den Schriftsteller Stendhal alternierende Formen dandyistischer Lebenskunst auftraten. So differiert beispielsweise der âMann von Weltâ vom zurĂŒckgezogenen Dandy durch seine Position âan vorderster Stelle aller VerrĂŒcktenâ. Seine offensive und nicht zurĂŒckgezogene Haltung zeigt, wie sehr sich ein sozialer Typus auch von verschiedenen sozialen und nationalen Umfeldern beeinflussen lĂ€Ăt und seine Haltung verĂ€ndert. Anhand der Texte wird deutlich, daĂ es gleichsam eine von Land zu Land sowie Zeit zu Zeit differierende PhĂ€nomenologie des dandyistischen Lebenskultes gibt. Diese hĂ€tte man zwar in der Einleitung zum Buch tiefgrĂŒndiger benennen können, sie erschlieĂt sich aber ansatzweise bei der LektĂŒre der Originaltexte beim aufmerksamen Lesen von selbst.
Generell wird in fast jedem Beitrag deutlich, daĂ der Dandy in einer Reihe von Sozialcharakteren hauptsĂ€chlich des 19. Jahrhunderts steht, die den Utilitarismus der sich industrialisierenden und verbĂŒrgerlichenden Gesellschaft ablehnten. Seine intellektuellen Bundesgenossen sind vor allen der BohĂšme und der Flaneur. Mehr und mehr erschlieĂen sich ĂŒber die Kapitel hinweg trotz variierender Grundmotive bei berĂŒhmten Dandys seine doch prĂ€gnanten Grundeigenschaften: Perfekte Selbstbeherrschung; Kampf mit der Gesellschaft; Kampf gegen die unĂ€sthetische Gegenwart; der Versuch, die eigene Anmut zu verkleiden und zu inszenieren, um bemerkt zu werden. Zugleich aber drĂ€ngt sich immer wieder die stoische Gelassenheit des nil admirari, in den Mittelpunkt, welche oft nur heroisch-oppositionelle Ausnahmemenschen aufzubringen in der Lage sind.
Die bewaffnete NeutralitĂ€t des Dandys beschreibt die Herausgeberin in ihrer kulturgeschichtlich dennoch gelungenen Einleitung trefflich: âEr vermischt sein distanziertes Auftreten so taktvoll mit Höflichkeit, dass sie an Ersterem nichts aussetzen können und Letzteres nicht zu fassen bekommen.â Wer dies nicht schafft, gerĂ€t zum Snob. Dieser Typus ist nicht zum Dandy geboren, möchte aber einer sein. Der Snob ist unvollendeter Nachahmer im Gewandt lĂ€cherlicher Eitelkeit â wie auch die Snobs Nietzsches, Churchills, Spenglers etc. Sie haben eben nicht formvollendet zu leben gelernt, was die Herausgeberin Grundmann als konstitutives Merkmal des Dandys hingegen ausmacht: âDer Dandy ist ein ĂŒberlegener Geist, ein Genie, unerwĂŒnscht in einer Gesellschaft, in der die Masse beherrschbar bleiben sollâ.
Das Buch ergĂ€nzt die LektĂŒre sinnvoll durch chronologisch enthaltene Bilder, auf denen der englische Maler Christopher Clark (1875-1942) das optisch Spezifische am jeweiligen Typus von Dandy, von politisch Apathischem und vom im Zeitalter der âdĂ©cadenceâ lebenden AuĂenseitertum in Abbildungen zu fassen versucht. Die politische Apathie der Unpolitischen ist Konsequenz der in diesem Buch beschrieben und ĂŒberhaupt jeder wiederkehrenden Zeit des Umbruchs. Sie ist Symbol einer real existenten und im Menschen reaktiv lebenden Modifikation von Verfall. â Der Mensch findet eben immer wieder neue Formen, um in der âdiaphtoraâ wĂŒrdig leben zu können.
geschrieben am 19.09.2007 | 741 Wörter | 4863 Zeichen
Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
âWas ist ein Dandy?â fragt Melanie Grundmann in ihrer Anthologie Der Dandy- Wie er wurde, was er war. Die Herausgeberin konstatiert, er sei âschwer zu greifenâ, der Dandy. Sie spricht von einer âetablierten Dandy-Forschungâ, ohne sagen zu können, welchen Autoren, welche BĂŒcher sie meint. Sie will ihn trotzdem irgendwie fassen. Aber er sei ja bloĂ âfleischgewordene Utopieâ, der Dandy. Also nicht fassbar? Von Absatz zu Absatz der Einleitung wird man unruhiger. Melanie Grundmann wirft Fragen auf, bleibt aber regelmĂ€Ăig Antworten schuldig. Um ihn zu fassen, den Dandy, muss sie auf berĂŒhmte BĂŒcher zurĂŒckgreifen. Meint sie diese vielleicht mit âForschungâ? Sie zitiert ausgiebig die wunderbare und gerade neu ĂŒbersetzte Studie des genialisch-verrĂŒckten Barbey dâAurevilly, - aber bleibt hinter dessen Erkenntnis zurĂŒck.
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Ăhnlich verhĂ€lt es sich auch mit den von ihr ausgewĂ€hlten StĂŒcken aus der Literaturgeschichte, die ihn uns nĂ€herbringen sollen, den Dandy. Sie sind amĂŒsant, interessant und machen tatsĂ€chlich ein wenig klarer, wie er sich kultur-soziologisch entwickelte. Was nun aber die Essenz des Dandys ist, erfahren wir nicht.
Essentiell ist das System der Machtentfaltung fĂŒr den Dandy, welches Otto Mann in einer philosophischen Doktorarbeit bei Karl Jaspers 1925 am Ur-Dandy George Bryan Brummell herausgearbeitet hat. Es beruhte auf den Faktoren Ăberlegenheit, VerhĂŒllung und VerblĂŒffung. Brummells geistige Ăberlegenheit ist die erste Voraussetzung seiner Machtentfaltung. Der Dandy beobachtet und analysiert die Welt - und dann sich. Er kommt zu dem Schluss, so wie die anderen nicht leben, nicht sein zu wollen. Er ist ein Ă€uĂerst genauer, sublimer und reflektierender Beobachter der AuĂenwelt. Die DandyattitĂŒde ist das Ergebnis seines Nachdenkens ĂŒber die eigene Lage, ĂŒber seine Position auf letztlich verlorenem Posten.
Der Dandy mit seiner asketischen Selbstregulierung ist verglichen worden mit dem Mönch in seiner Zelle. Die kompromisslose Perfektion im ĂuĂeren ist nur eine Facette der brummellschen Ăberlegenheit.
Der Dandy wird deshalb von den anderen bewundert, weil er die SouverĂ€nitĂ€t seiner Ăberlegenheit spĂŒrt â und zelebriert. Der Dandy wird heute hĂ€ufig mit dem Snob verwechselt, weil in der Regency-Periode die Bedeutung der Mode auf einem kaum je wieder erreichten Höhepunkt war. â(G)utes Aussehen und Ă€uĂerliche Eleganzâ sind âdem vollkommenen Dandy lediglich ein symbolischer Ausdruck fĂŒr die aristokratische Ăberlegenheit seines Geistesâ, schrieb Charles Baudelaire. Die Ăberlegenheit des Dandys zeigt sich im GesprĂ€ch. Brummells Biographen betonen einhellig, dass es nicht seine Kleidung gewesen sei, die ihn zum first gentleman of europe habe avancieren lassen. Seine herausragende Konversationskunst war es, nie monologisch, stets bezog er die anderen mit ein, denen er sowohl rhetorisch wie auch durch seine profunde Allgemeinbildung ĂŒberlegen war. Brummells Art der Unterhaltung war wie sein Humor: Immer leicht ironisch und damit grundsĂ€tzlich unberechenbar. Sein Witz war trocken, selbstironisch und dadurch stets unterhaltsam und andererseits unangreifbar.
In ihrer GesprĂ€chskunst Ă€hneln sich die groĂen historischen Vertreter dieses Typus auffĂ€llig. Lesen wir ĂŒber Brummell, sind wir sogleich an Oscar Wilde erinnert, der seine VortrĂ€ge immer im GesprĂ€ch begann, mit vielerlei theatralischen Gesten, seine Zigarette schwenkend und letztlich bedeutungsvoll in das Kaminfeuer werfend. Wir erinnern uns an die Reden Gabriele dâAnnunzios in Fiume, an die Pariser Jahre Ernst JĂŒngers. Heute erinnert uns Karl Lagerfeld an diese groĂartigen Blitzlichter der europĂ€ischen Kulturgeschichte, wenn er zu Sandra Maischberger sagt: âIch bin ein ganz anderer.â
VerblĂŒffung setzt ein Publikum voraus, ein GegenĂŒber. Der Dandy âsammelt sich selbstâ, wie Albert Camus es beschrieben hat und schmiedet seine eigene Einheit dadurch, dass er sich mit den anderen nicht gemein macht. Er steht wesensmĂ€Ăig zwangslĂ€ufig in der Opposition; âder Dandy kann sich nur aufstellen, indem er sich entgegenstellt. Er kann sich seiner Existenz nur versichern, wenn er sie im Gesicht der anderen wiederfindet.â Das GegenĂŒber, der andere, der provoziert, umschmeichelt, verletzt oder schockiert wird, ist zwangslĂ€ufiger Bestandteil der DandyattitĂŒde. âDie andern sind der Spiegel.â
GĂŒnter Erbe schreibt in seiner Einleitung zu dieser Anthologie: âDer Geist des Dandys lotet nicht tief.â Ein schwerer Irrtum.
geschrieben am 13.02.2009 | 627 Wörter | 3914 Zeichen









Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen